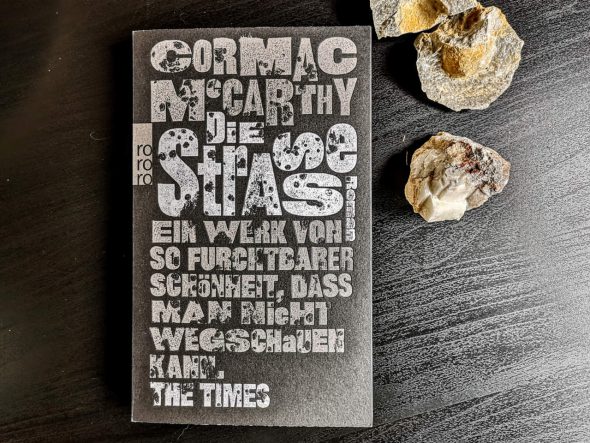Dieses Buch ist schon etwas älter, es erschien in der Originalausgabe bereits 2006. Aber für einen Streifzug durch die Apokalypse ist es nie zu spät – und genau darum geht es in „Die Straße“.
In einem Anflug von „Bock auf Apokalypse-Geschichten“ setzte ich das Buch vor nicht allzu langer Zeit auf meine Amazon-Wunschliste, und siehe da, es ist kaum zu glauben, kurz darauf lag das Buch als Geschenk in meinem Briefkasten! Vielen Dank an Eric an dieser Stelle, ich habe mich riesig gefreut :D
Okay, ich muss ein wenig revidieren. Es geht in „Die Straße“ nicht um die Apokalypse, sondern die gibt nur den Rahmen für die Handlung in diesem Buch. Wenn ich versuche, mir das Buch als Bild vorzustellen, dann hätten wir als Hintergrund eine zerstörte, bösartige und schemenhafte Welt in deprimierenden Grautönen. Aber im Vordergrund sitzen in farbigen Pinselstrichen ein Mann und ein kleiner Junge an einem kleinen Feuer, das ein wenig Licht und Wärme in die Umgebung wirft.
„Die Straße“ setzt emotional zu, die detaillierte Beschreibung einer erbarmungslosen Welt nach irgendeiner apokalyptischen Katastrophe hat mich ziemlich mitgenommen. Und darum ist das Buch klasse – denn sowas schaffen nicht viele Bücher!
Die Straße – Handlung
Titel: Die Straße
Erstveröffentlichung: 2006
ISBN: 978-3499246005
Seiten: 253
Weiteres: Wurde als „The Road“ verfilmt (2010)
Die Welt ist wüst und leer. Vielleicht acht oder zehn Jahre, bevor wir dazu stoßen, hat irgendein Ereignis nicht nur die menschliche Zivilisation, sondern im Prinzip fast alles Leben auf der Erde zerstört. Was genau das war, das verrät McCarthy nicht. Wir wissen nur, dass die Erdoberfläche nachhaltig verbrannt ist und noch immer Asche durch die Luft taumelt, die alles eindeckt. Durch die dichte Wolkendecke dringen nicht einmal Sonnenstrahlen, so dass jeder Tag grau, kalt und nass erscheint.
Es gibt kaum noch Tiere und auch die meisten Pflanzen sind abgestorben. Die restlichen Menschen sind zu Marodeuren oder, schlimmer noch, Kannibalen geworden, weil es einfach nichts mehr zu essen gibt. Nichts zu jagen, nichts anzubauen – die einzige Hoffnung sind Lebensmittelreserven, die noch niemand anderes gefunden hat. Oder eben Menschenfleisch.

Hier zählt nur noch das Recht des Stärkeren – oder man geht diesen „Bösen“ aus dem Weg. Genau das tun die beiden namenlosen Protagonisten des Buches auch: Der Mann und sein Sohn. Der Mann teilt die überlebenden Menschen in die Guten und die Bösen auf, um seinem Sohn moralische Werte zu vermitteln. Sie beide gehören zu den Guten, und das bedeutet: Man tut anderen Menschen nichts zuleide, außer, es gar nicht anders. Und es bedeutet auch: Die Guten überleben. Zumindest hätten sie das verdient. Damit macht der Mann dem Jungen Hoffnung auf die Zukunft.
In der Nacht wachte er auf und lauschte. Er konnte sich nicht erinnern, wo er war. Der Gedanke brachte ihn zum Lächeln.
Cormac McCarthy – Die Straße
Wo sind wir?, sagte er.
Was ist denn, Papa?
Nichts. Alles in Ordnung. Schlaf weiter.
Wir schaffen es doch, oder, Papa?
Ja. Wir schaffen es.
Und uns wird nichts Schlimmes passieren?
Richtig.
Weil wir das Feuer bewahren.
Ja. Weil wir das Feuer bewahren.
Aber zur Sicherheit schlagen sich die beiden allein durch. Sie wandern frierend und hungrig durch die zerstörte Welt, in der Hoffnung, irgendwo andere „Gute“ zu finden, oder zumindest einen Ort, an dem sie bleiben können. Diesen Ort haben sie bisher nicht gefunden, es ist zu gefährlich, lange an einem Platz zu bleiben und sich einzurichten.
Ihr Ziel ist das Meer – der kleine Sohn hofft, den Ozean so blau zu sehen, wie er früher gewesen war, vor seiner Geburt. Doch der Vater hat insgeheim keine großen Hoffnungen, dass das Meer wirklich blau ist oder es dort irgendwas anderes gibt, was ihre jahrelange Reise zu einem Ende führen könnte.
Der Sohn kennt die „alte Welt“ gar nicht mehr, er kam kurz nach der Apokalypse zur Welt. Sein Vater dagegen träumt manchmal noch davon. Auch von seiner Frau, die schon vor Jahren Selbstmord begangen hat. Es sind gefährliche Träume, weil sie ihn von der traurigen, grauen Realität ablenken und in ihm den Wunsch wecken, seiner Frau zu folgen.
Eine wahre Horrorvision
Als „Apokalypse-Junkie“ fühlte ich mich gut vorbereitet und war gespannt, wie McCarthys Version der Postapokalypse aussieht. Aber weder Filme und Serien wie Mad Max, Terminator oder Walking Dead noch Spiele wie Division oder Bücher wie Stephen Kings The Stand kommen dieser Version in ihrer Hoffnungslosigkeit auch nur nahe.
Die Postapokalypse wirkt normalerweise auf mich anziehend, weil jemand einen großen Reset-Knopf gedrückt hat. Das riesige Hamsterrad aus Gewinnmaximierung, Überbevölkerung und Umweltverschmutzung wird angehalten und die Überlebenden werden mit ihren Grundbedürfnissen konfrontiert.
Bei den meisten anderen fiktiven Postapokalypsen geht es entsprechend auch darum, Strukturen der Ordnung wiederherzustellen. Sobald das gelungen ist, kann man alles besser machen. Es geht also um Hoffnung und Wiederaufbau. Oder zumindest um eine Gemeinschaft von „Guten“, die sich gegen eine große Bedrohung zusammenschließen.
In McCarthys zerstörter Welt sind Hoffnung und Optimismus aber undenkbar. Es gibt all das, was auch die anderen Visionen bieten: Ausgestorbene Landstriche mit zvilisatorischen Überresten wie geplünderten Häusern und Staus aus verlassenen Autos, dazwischen hin und wieder irgendwelche anarchistischen Gruppen, die andere Überlebende terrorisieren.
Was bei McCarthy aber fehlt, sind wärmendes Sonnenlicht, die Natur, die sich endlich wieder Raum verschafft und vor allem Sicherheit bietende Gemeinschaften, denen daran gelegen ist, eine neue, faire Gesellschaft aufzubauen.
Hier gibt es nur einen Mann und einen Jungen. Ständig kurz vor dem Verhungern oder Erfrieren. Immer auf der Flucht. Ganz auf sich allein gestellt – und das seit Jahren. Ihre Besitztümer schieben sie in einem Einkaufswagen über die Straße, die Füße mit Lumpen umwickelt, den Revolver mit nur zwei Schuss Munition stets griffbereit. Der Mann wünscht sich, es endlich hinter sich zu haben, nur die Liebe zu seinem Sohn lässt ihn weiterleben.
Ein Eindruck von Verdun und Stalingrad
Schon nach nur wenigen Seiten färbte die Stimmung des Mannes auf mich ab. Ich fühlte mich selbst kalt und einsam, und auf einmal hielt ich meine eigenen Apokalypse-Sehnsüchte für ziemlich naiv. Sowas kann sich niemand wünschen. Was haben wir doch ein gutes Leben in Sicherheit, Wärme und umgeben von wohlmeinenden Menschen.
Gleichzeitig fragte ich mich: Wie kann sich ein Mensch so eine Horrorvision ausdenken, ohne es ansatzweise selbst erlebt zu haben? Ich dachte mir, dass vielleicht Soldaten in den Schützengräben von Verdun im 1. Weltkrieg oder in Stalingrad im 2. Weltkrieg so eine Hoffnungslosigkeit erlebt haben. So eine Reduzierung ihrer Bedürfnisse auf das Allernötigste, während um sie herum die Welt in Schlamm, Kälte und Granatsplitter zerfällt.
Er hatte dieses Gefühl, das über die Benommenheit und dumpfe Verzweiflung hinausging, schon einmal gehabt. Dass die Welt auf einen rohen Kern nicht weiter zerlegbarer Begriffe zusammenschrumpfte. Dass die Namen der Dinge langsam den Dingen selbst in die Vergessenheit folgten. Farben. Die Namen von Vögeln. Dinge, die man essen konnte. Schließlich die Namen von Dingen, die man für wahr hielt. Zerbrechlicher, als er gedacht hätte.
Cormac McCarthy – Die Straße
Laut Wikipedia kämpfte McCarthy allerdings in keinem Krieg, also muss er wohl nur eine ziemlich dunkle Fantasie haben. Hilfreich ist bestimmt auch sein Alter und die Tatsache, dass er ein Landmensch ist. McCarthy wurde 1933 geboren und kennt die Welt noch ohne Plastik, ohne Globalisierung und ohne Internet.
Er weiß also, wie landwirtschaftliche Geräte funktionieren, wie eine Scheune aufgebaut ist, wo man ziehen muss, um Luken aufzubekommen. Wäre ich Schriftstellerin, hätte ich nicht so akkurat beschreiben können, wie Vater und Sohn Häuser, Scheunen und Schutzbunker durchsuchen.
Für die Darstellung seiner Welt nutzt er nicht nur detaillierte Beschreibungen und präzise Begrifflichkeiten wie Riedgras und Drahtkrampen, sondern auch vielsagende Adjektive, die dem Leser ständig die düstere Stimmung ins Gesicht blasen: Verbrannte Bäume, tote Tannennadeln, namenlose Finsternis, kriechende Kälte.
Vater und Sohn gemeinsam allein
McCarthy gelingt es durch seine bildhaften Beschreibungen sehr gut, ein Bild von seiner Apokalypse-Version zu zeichnen. „Die Straße“ hat ansich keine Handlung oder einen Spannungsbogen, sondern es ist die Beschreibung einer Reise. Sie dient einerseits dazu, fantasievoll die gnadenlose Umwelt und das Überleben der beiden darin zu beschreiben.
Andererseits und als Kontrast dazu zeichnet McCarthy die herzerweichende Beziehung von Vater und Sohn. Immer wieder schaut der Vater seinen schlafenden Sohn voller Liebe an. Nur für ihn kämpft er überhaupt weiter. Genau so drückt er es auch aus, als der Sohn in einmal danach fragt, was er, der Vater, denn machen würde, wenn er, der Sohn, stürbe. „Ich würde mit dir kommen wollen“, antwortet der. Seine Welt dreht sich nur um seinen Sohn, und darum, dass dessen Herz weiterschlägt.
Und das, obwohl weder er noch das Leben selbst dem Jungen irgendetwas bieten kann außer ständige Entbehrung und Angst. Er ist die einzige Bezugsperson des Jungen, und die beiden letzten Revolverkugeln dienen ihm im Zweifel auch dazu, dem Ganzen ein Ende zu setzen, sollten die Bösen sie doch noch erwischen.
Der Junge ist aber auch lieb. Im Buch steht er für Unschuld, Gnade und Güte. Er wurde in diese zerstörte Welt hineingeboren und weiß, dass sein Leben ständig auf dem Spiel steht, sei es durch Hunger oder die „Bösen“. Dennoch sorgt er sich um andere Menschen, wenn die beiden ihnen mal begegnen. Er teilt gern sein Essen und weint, wenn sie anderen nicht helfen konnten.
Sein Vater hat diese „Naivität“ schon längst abgelegt, weil er weiß, dass das sicherer ist. Vielleicht möchte er das Leben seines Sohnes aber auch deswegen um jeden Preis schützen, weil damit dann der letzte Rest Menschlichkeit und Güte aus der Welt verschwinden würde. Der Sohn „bewahrt das Feuer“, wie es im Buch heißt.
Eigenwillige, aber vielsagende Dialogsform
Die Dialoge der beiden sind sehr sparsam und etwas eigenwillig. McCarthy reduziert sie, passend zu den Bedürfnissen der beiden, auf das Notwendigste. Mann und Junge sind schon seit Jahren gemeinsam unterwegs. Was sollte man da auch groß erzählen, wenn man alles zusammen macht und mit niemandem sonst spricht?
Aber obwohl McCarthy sowohl Vater als auch Sohn nur kurze Sätze sagen lässt, sind diese Dialoge sehr eindringlich. Der Leser erfährt nur über das Hin- und Herwerfen des „Gesprächsballs“ sehr viel über die beiden: Was den Sohn beschäftigt und was er sich wünscht. Wann er an den Worten des Vaters zweifelt. Wie er sich fühlt. Und der Vater lässt durchblicken, ob er gerade besorgt ist oder unter Stress steht.
Der fallende Schnee umfing sie wie ein Vorhang. Weder auf der einen noch auf der anderen Straßenseite war etwas zu erkennen. Er hustete wieder, und der Junge fröstelte, während sie Seite an Seite, das Stück Plastikplane über ihre Köpfe gezogen, den Einkaufswagen durch den Schnee schoben. Schließlich blieb er stehen. Der Junge zitterte unkontrollierbar.
Cormac McCarthy – Die Straße
Wir müssen haltmachen, sagte er.
Es ist wirklich kalt.
Ich weiß.
Wo sind wir?
Wo wir sind?
Ja.
Ich weiß nicht.
Wenn wir sterben müssten, würdest du es mir dann sagen?
Ich weiß nicht. Wir müssen nicht sterben.
McCarthy lässt bei den Dialogen alles Unnötige, wie etwa Gesichtsausdrücke, Seitenblicke und Tätigkeiten nebenbei, weg und lässt sie für sich stehen, und genau das reicht, um sich alles Wichtige zum Gespräch selbst zusammenzureimen.
Allerdings ist es dadurch nicht immer sofort ersichtlich, wer welchen Satz sagt. Meistens ergibt sich das aus dem Kontext bzw. durch die Abwechslung der Gesprächspartner im Dialog, aber hin und wieder sagt auch einer zweimal etwas hintereinander und dann kommt man durcheinander ^^
Dieser externe Inhalt ist aufgrund deiner Datenschutzeinstellungen gesperrt. Klicke auf den Button, um den Inhalt von ws-eu.amazon-adsystem.com zu laden.
Die Straße – Wertung
Du siehst: „Die Straße“ hat mich ziemlich beeindruckt. Es ist eine bedrückende Geschichte, die den Leser mitzieht, vielleicht sogar mit in den Abgrund. Nach nicht einmal 24 Stunden legte ich aufgewühlt das durchgelesene Buch weg. Und war sogar ein wenig erleichtert, nun wieder in die „Welt von Licht und Wärme“ zurückkehren zu können.
Cormac McCarthy schreibt schlicht, aber eindrücklich. Die recht dünne Story ist hier nebensächlich, es geht mehr um die Schilderung von Umständen, die die Vorstellungskraft des Lesern wecken und zugleich strapazieren.
Wer sich für postapokalyptische Welten interessiert und dabei keinen steilen Spannungsbogen braucht, der sollte sich dieses Buch mal anschauen! Zumal, wie ich erst jetzt am Ende meiner Rezension herausfinde, McCarthy dafür den Pulitzerpreis erhielt und das Buch auch hochkarätig, aber offenbar enttäuschend als „The Road“ verfilmt wurde.




» So funktioniert die Buchbewertung